Generalisierte Angststörung
Was ist eine Generalisierte Angststörung?
Die Diagnose einer „generalisierten Angststörung“ trifft dann zu, wenn die Besorgnis und Anspannung bezüglich alltäglicher Ereignisse mindestens 6 Monate vorhanden ist und verschiedene körperliche und psychische Symptome vorliegen, zum Beispiel:
- Herzklopfen
- Schweißausbrüche
- Kribbeln im Magen
- Schwindel
- Angst, verrückt zu werden oder zu sterben
- Hitzegefühl oder Kälteschauer
- Muskelverspannungen
- Konzentrationsschwierigkeiten
- Reizbarkeit
- Einschlafstörungen
Die Betroffenen versuchen oft, Auslöser für die Ängste (z.B. Berichte über Unfälle) zu vermeiden oder versuchen, sich zum Beispiel bei ihren Angehörigen zu versichern, dass es diesen gut geht und nichts passieren wird. Da Angehörige die Sorgen auch oft als belastend erleben, kann es zu Konflikten kommen.
Wie häufig sind Generalisierte Angststörungen?
Gibt es unterschiedliche Formen oder Verläufe?
Liegen neben der generalisierten Angststörung gleichzeitig weitere Erkrankungen vor, hat die Störung häufiger einen chronischen Verlauf. Wenn die Erkrankung nicht behandelt wird, besteht ein hohes Risiko, dass sie lange bestehen bleibt, wobei es beim Schweregrad häufig Schwankungen gibt: Viele Patient*innen erleben zwar Zeiten, in denen sie frei von Symptomen sind, bei ungefähr der Hälfte der Personen treten aber später erneut Beschwerden auf. Bei vielen Betroffenen dauert es darüber hinaus mehrere Jahre, bis sie Hilfe aufsuchen.
Wie entsteht eine Generalisierte Angststörung?
Einflüsse, die man ererbt hat (genetische Einflüsse) können bei der Entwicklung von Ängsten eine Rolle spielen.
Bei Menschen mit einer generalisierten Angststörung kann man in bestimmten Bereichen des Gehirns mehr Aktivität nachweisen als bei anderen Menschen. Vermutlich sind bei Menschen mit Angststörungen Botenstoffe im Gehirn, die für Entspannung sorgen, weniger vorhanden oder können schlechter wirken.
Manche Menschen, die eine Angststörung entwickeln, hatten als Kinder keine sichere Bindung z.B. zu ihren Eltern oder anderen nahen Bezugspersonen. Sie haben das Verhalten ihrer nahen Bezugspersonen manchmal als unvorhersehbar erlebt.
Für Menschen mit generalisierter Angststörung ist es häufig schwerer auszuhalten als für andere Menschen, dass man keine „absolute Sicherheit“ hat (Beispiel: im Straßenverkehr, am Arbeitsplatz). Sie reagieren sehr sensibel auf Reize, die eine Gefahr darstellen könnten. Mehrdeutige Reize (also Ereignisse, die harmlos oder bedrohlich sein können) werden eher als bedrohlich eingeschätzt. Betroffene glauben, dass sie Dinge nicht ändern oder kontrollieren können, was wiederum Angst auslöst.
Viele Betroffene nehmen an, dass sie sich durch Sorgen vor Enttäuschungen schützen oder ein Unglück abwenden können. Hinter diesen positiven Annahmen über Sorgen steckt die Idee: Wer vorsichtshalber schon einmal Angst hat, dass etwas passieren könnte, ist dann nicht enttäuscht, wenn es auch wirklich passieren sollte.
Wie findet man heraus, ob man eine Generalisierte Angststörung hat?
In einem Gespräch werden Ärzt*innen oder Psychotherapeut*innen nach den einzelnen Beschwerden, dem allgemeinen Gesundheitszustand, der Familiengeschichte und nach körperlichen Erkrankungen fragen und überprüfen, ob eine generalisierte Angststörung vorliegt. Fragebögen helfen dem Therapeuten, die Schwere der Erkrankung einzuschätzen und abzuklären, ob noch andere psychische Probleme als Ursache in Frage kommen. Eine körperliche Untersuchung kann klären, ob die Symptome – besonders die Körperbeschwerden – körperliche Ursachen haben.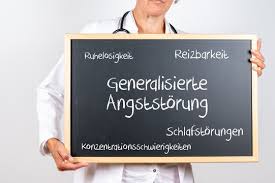
Wie werden Generalisierte Angststörungen behandelt?
Sogenannte Benzodiazepine (Medikamente, die schnell beruhigen) können zwar kurzfristig helfen, jedoch sollten diese nur in absoluten Ausnahmefällen verordnet werden, da sie – im Gegensatz zu den anderen Medikamenten – abhängig machen können.
Durch Psychotherapie können Betroffene lernen, mit ihren Sorgen umzugehen und die begleitenden körperlichen und psychischen Beschwerden zu reduzieren (z.B. durch Entspannungstechniken), so dass diese nicht mehr so belastend sind. Das Verfahren, welches am besten untersucht ist und sich als langfristig wirksam erwiesen hat, ist die kognitive Verhaltenstherapie.
Wenn ein Patient lieber mit einem psychodynamischen Psychotherapieverfahren behandelt werden möchte oder die Verhaltenstherapie nicht gewirkt hat, können diese Verfahren auch eingesetzt werden. Sie sind jedoch bislang für die generalisierte Angststörung weniger gut untersucht als die Verhaltenstherapie.
Was können Freunde oder Angehörige tun?
Es ist hilfreich, wenn Angehörige gut über die generalisierte Angststörung Bescheid wissen. Möglichst sollten sie vermeiden, die betroffene Person immer wieder zu beruhigen, da dies zwar oft kurzfristig hilft, langfristig aber die Sorgen aufrechterhält.
Für das Wohlbefinden ist es wichtig, dass Angehörige sich selbst nicht zu sehr einschränken. Sie sollten zum Beispiel nicht auf Aktivitäten verzichten, die ihnen Freude bereiten, weil der Betroffene sich dann sorgen würde. Wird die Angsterkrankung der Partner*in, des Familienmitglieds oder der Freund*in zu belastend, können sich auch Angehörige Hilfe bei Selbsthilfegruppen, Beratungsstellen, Ärzt*innen und Psychotherapeut*innen holen.
Zurück nach oben zum Start Generalisierte Angststörungen
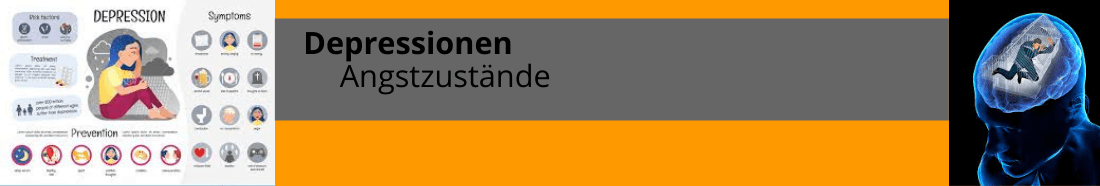 depressionen.thomaskroebl.com Angstzustände
depressionen.thomaskroebl.com Angstzustände